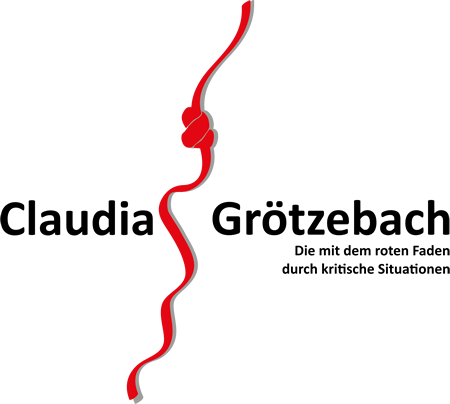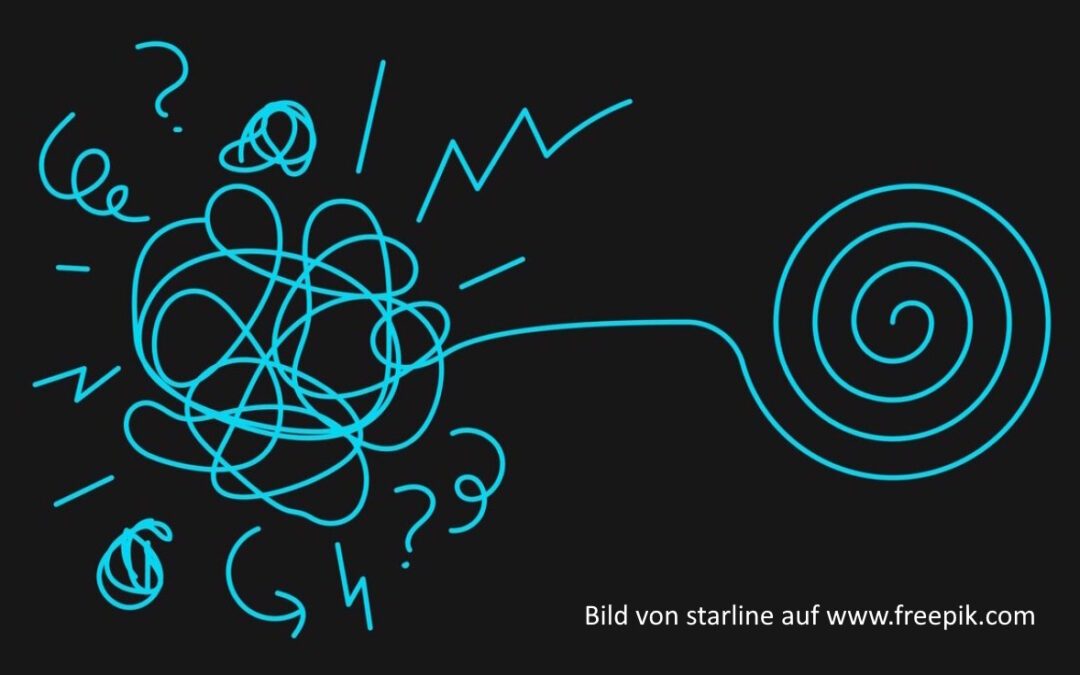Menschen in der Krise - Menschen im Tunnel
Ein Blick auf den Überlebensmodus unseres Gehirns und seine psychologischen Folgen

Das Krisenparadox
Von außen betrachtet wirkt es oft paradox: In Krisen brauchen Menschen eigentlich Hilfe und Unterstützung, doch gerade dann sind die Betroffenen für Dritte oft nicht erreichbar. Sie denken und handeln wie in einem Tunnel. Manche sind völlig passiv und erstarrt. Andere, über die ich in diesem Artikel sprechen will, sind extrem fokussiert und manisch auf „Erledigung“ programmiert. Rationale Argumente prallen an ihnen ab, klärende Gespräche scheitern, Innehalten und Planungsgespräche wirken wie Zeitverschwendung. Stattdessen erleben wir fieberhafte Aktivität, hektisches Handeln, übertriebene Kontrollversuche – oder im Gegenteil völligen Rückzug. Doch was passiert hier eigentlich genau?

Der Mensch im Überlebensmodus
Der Streit, die berufliche Krise, der Shitstorm oder der persönliche Verlust – egal ob die Krise, in der wir uns befinden auf realen Gefahren beruht oder nicht: Krisen bedeuten Stress und versetzen uns in einen Alarmzustand.
Unser Gehirn legt bei einer potenziellen Bedrohung einen Schalter um und damit übernimmt bei emotionalen Belastungen nicht unser rationales Denken, sondern tiefere, evolutionär ältere Hirnregionen die Kontrolle: der sogenannte limbische Bereich, oft auch als „emotionales Gehirn“ bezeichnet.
Statt klar zu analysieren und zu reflektieren, greifen wir auf automatische Muster zurück. Intuition, Instinkt, Erfahrung – all das tritt in den Vordergrund. Das kann sinnvoll sein, wenn es um unmittelbare Gefahren geht. Doch im beruflichen oder sozialen Kontext führt es häufig dazu, dass Menschen scheinbar irrational, unkooperativ oder „nicht erreichbar“ wirken.
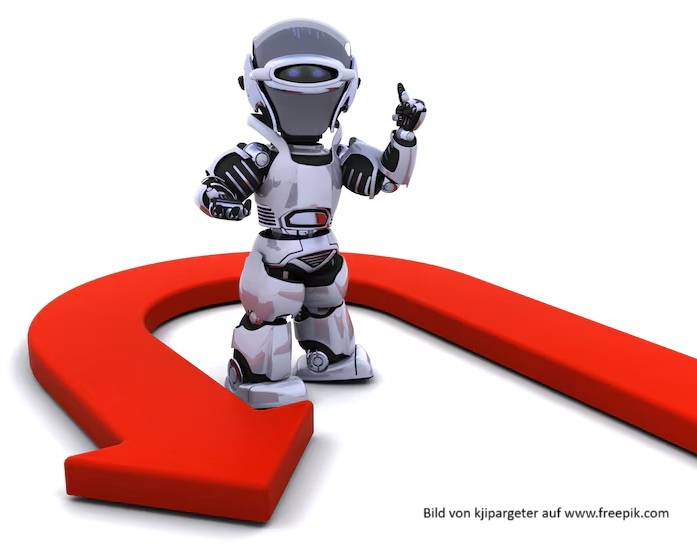
Aktionismus statt Analyse
In der Krise dominiert neben der totalen Passivität oft ein beinahe manischer Aktionismus. Es wird gehandelt, organisiert, kommuniziert – in hoher Geschwindigkeit, oft ohne klar erkennbare Strategie. Der Fokus liegt auf Aktivität, nicht auf Reflexion. Warum?
Weil Handlung suggeriert, dass wir Kontrolle haben. In der psychischen Notlage liefert das schnelle Agieren ein Gefühl von Einfluss und Wirksamkeit. Es schützt die fragile innere Stabilität. Wer handelt, ist (scheinbar) nicht ohnmächtig. Und dieses Gefühl ist in kritischen Momenten überlebenswichtig für die innere Balance.

Die Krise aus der Sicht Dritter
Außenstehende erleben diese Phasen oft als frustrierend. Der Mensch in der Krise wirkt unerreichbar, abgetaucht, unfreundlich, vielleicht unzuverlässig, macht nicht, was er aus Sicht Außenstehender soll. Hier versuchen sie einzugreifen, korrigieren, mahnen, tadeln und erhöhen so den Druck noch zusätzlich. Viele verstehen nicht, was da gerade neben ihnen abläuft.

Pausenlos gegen das Chaos
Was in Krisen normalerweise fehlt, sind Pausen, kurze Unterbrechungen – zum Durchatmen, zum Nachdenken, zum Planen. Doch genau das wäre notwendig, um aus der impulsiven Reaktion in ein bewusstes Handeln zu kommen. Dafür braucht es einen sicheren Raum und manchmal auch einen externen Impuls: einen Coach, eine Führungskraft, ein gutes Gespräch, das nicht bewertet, sondern begleitet und die Ängste und Nöte aufnimmt und so die Belastung mildern hilft.

Der Einbruch danach
Spannend ist, was oft nach der ersten akuten Phase geschieht: Der Körper fährt herunter, das Denken wird wieder möglich – und mit dem Denken kommt oft der emotionale Einbruch. Jetzt kommt es zum Bewußtwerden und Begreifen: Was ist da eigentlich passiert? Was ist mir passiert? Was ist verloren? Welche Krise habe ich da erlebt? Was habe ich gesagt, getan, vielleicht auch zerstört? Trauer, Frust, Verzweiflung, Schuldgefühle, Zweifel, Erschöpfung folgen auf die heiße Phase, manchmal sogar depressive Verstimmungen.
An dieser Stelle beginnt die eigentliche psychische Verarbeitung der Krise. Und jetzt wird Unterstützung oft dringender gebraucht als vorher – auch wenn sie dann weniger sichtbar nach außen gefragt wird.

Was hilft?
Ein zentrales Ziel in der Begleitung von Menschen in kritischen Phasen ist, ihnen wieder ein Gefühl der Kontrolle zurückzugeben – ohne in blinden Aktionismus zu verfallen. Dazu gehören:
- Emotionen zulassen: Nicht „wegcoachen“, sondern ernst nehmen und begleiten, die Ängste und Nöte aufnehmen.
- Raum schaffen: Zuhören, ohne sofort Lösungen zu präsentieren.
- Struktur geben: Klare Schritte, kleine Entscheidungen, Orientierung bieten und Hilfsangebote, im Sinne des Partners.
- Pausen ermöglichen: Ermutigen, innezuhalten, zu reflektieren, durchzuatmen.
- Selbstwirksamkeit stärken: Kleine Erfolge sichtbar machen.
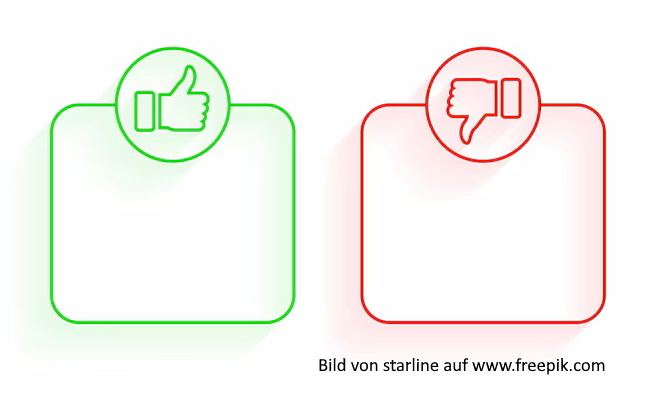
Fazit
Wenn Menschen in der Krise nicht erreichbar scheinen, dann nicht, weil sie nicht wollen – sondern weil sie gerade kämpfen. Um Orientierung, um Kontrolle, um emotionale Stabilität. Verständnis für diese inneren Prozesse ist der erste Schritt zu einer wirksamen Begleitung. Denn wer den Überlebensmodus erkennt, kann Wege zeigen, ihn zu verlassen.